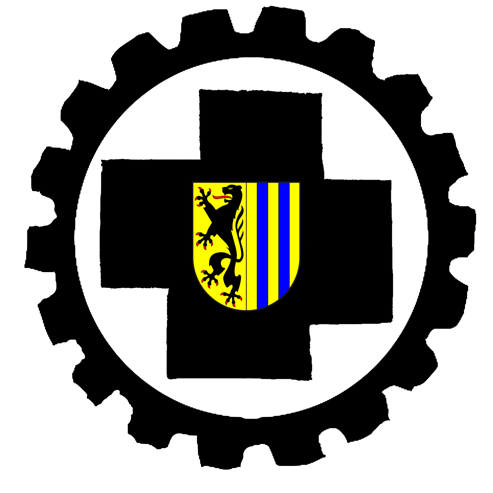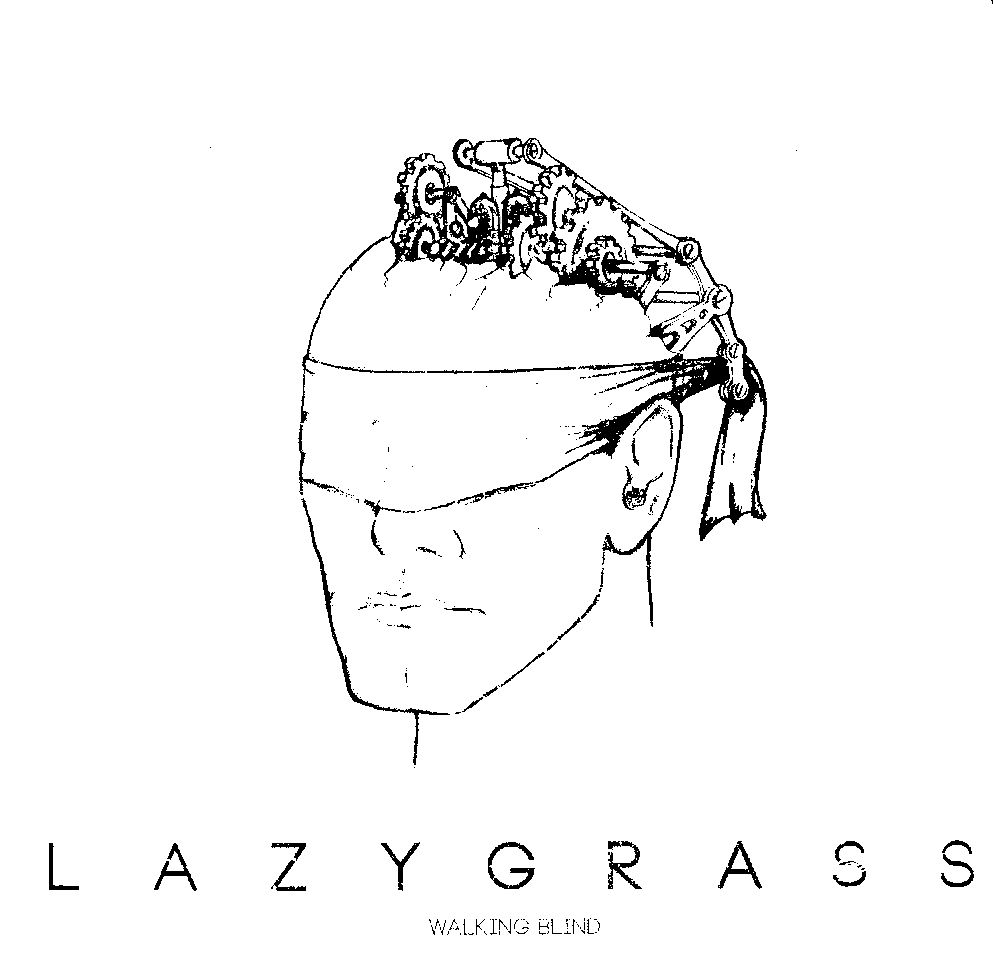„Fasst euch ein Herz“ heißt die vierte Studioscheibe des immer bekannter werdenden Pflastersteinmusikanten Felix Meyer. Mehrfach schon gastierte er in Leipzig. Die ihn betreuende Plattenfirma „Löwenzahn“ hat in der Messestadt ebenfalls seinen Sitz. Am 15. April weilt er erneut in Klein-Paris. Dieses Mal treibt es ihn in das Täubchenthal. Im folgenden Interview spricht er über seine Herzensangelegenheit – die Musik.
Vom Straßenmusiker zum Bühnenbespieler in ausverkauften Häusern. Ist es Zeit, ein Fazit zu ziehen?
Das Projekt „Felix Meyer“ ist jetzt ungefähr sieben Jahre alt. Es befindet sich gerade an dem Punkt, wo wir von der Straße weggeholt wurden. Das ist eigentlich auch schon ein paar Jahre her, aber wir haben dann doch länger Straßenmusik gemacht, als sich manch einer das vielleicht gewünscht hätte. Es hat uns einfach soviel Spaß gemacht, dass wir immer weiter machen mussten, aber nun ist so langsam mit dieser Straßengeschichte Schluss. Ich hab jetzt 20 Jahre Straßenmusik gemacht, das reicht nun. Wir sind inzwischen wirklich auf der Bühne angekommen und haben in den letzten Jahren zwischen 60 und 70 Konzerte und Festivaltermine gespielt und fühlen uns da recht wohl. Wir sind dort angekommen und wir haben das Gefühl, da gehören wir auch hin.
Was ist das „Project île“?
Seit einigen Jahren ist es die gleiche Band, bestehend aus insgesamt sechs Leuten, mit mir. „Project île“ ist deswegen entstanden, weil wir seit Jahren schon überlegen, ob wir einen Namen für diese Bande finden könnten. Es gab ganz früher schon mal einen, als wir ohne eigene Lieder durch Europa getingelt sind – eben diesen Bandnamen „Project île“, was eine Art Fantasiemischwort aus Englisch und Französisch ist und sozusagen das Inselprojekt beschreibt. Mit denen waren wir schon jahrelang unterwegs und als ich jetzt mal wieder die Band gefragt habe, was sie sich für einen Bandnamen vorstellen könnten, sagte Claudius zu mir: „Lass uns doch einfach den nehmen, den ihr früher schon hattet, der ist doch hübsch“. Nun heißt es Felix Meyer und „Project île“, um eben der Band auch mal ein Gesicht und einen Namen zu geben.
Was hat sich bei diesem Album musikalisch gegenüber den Vorgängern geändert?
Von der Art und Weise die Lieder zu entwickeln, hat sich gar nicht so viel verändert, aber dadurch das es vor drei Jahren eine Änderung in der Besetzung gab, sind die Tasteninstrumente wichtiger geworden und vor allem die Art der Aufnahme hat sich verändert. Während wir die ersten drei Studioalben so produziert haben, dass wir eigentlich mit relativ rohem Material ins Studio gegangen sind und dann vor Ort erst die Lieder entwickelten, haben wir es diesmal anders herum gemacht. Wir konnten die Lieder vorher schon und wussten in allen Einzelheiten, wie sie klingen sollen. Wir haben auch Testkonzerte veranstaltet, also ein paar Konzerte vor Publikum nur mit dem neuen Programm gespielt. Mit dieser Erfahrung sind wir ins Studio gegangen und haben die Sachen alle live eingespielt. Das hatten wir vorher noch nie getan. Wir hatten aber immer davon geträumt mal eine Platte ganz live aufzunehmen, so dass man merkt, dort stehen Leute zusammen in einem Raum und machen Musik. Im Gegensatz zu den Platten davor, bei denen erst das Schlagzeug aufgenommen wird, dann der Bass und anschließend wird alles noch dreimal zerhackt und wieder neu zusammengesetzt. Am Ende hat man gar nicht mehr unbedingt das Gefühl, dass da Menschen in einem Raum zusammen Musik gemacht haben und das hat man bei der neuen Platte sehr deutlich, was ich sehr schön finde. Man wird in zehn Jahren noch genau vor Augen haben, wer in diesem Studio stand und kann an den Instrumenten, die Persönlichkeit jener Leute erahnen, die das Album gespielt haben.
In welchem Studio fanden die Aufnahmen statt und was war eventuell im Studio diesmal anders?
Die ersten drei Studioalben sind bei Franz Plasa in Hamburg entstanden. Da wir diesmal etwas anderes ausprobieren wollten, haben wir das erste mal mit Thommy Krawallo zusammengearbeitet. Der hat sich in Brandenburg in einem kleinen Dorf ein Schulhaus gekauft, in Golzow, und hat dort ein wunderschönes Studio. Es liegt mitten in der Natur, hinten fließt ein Fluss lang. Es gibt tolle, große Räume und man fühlt sich dort schnell sehr wohl. Da wir die Lieder vorher schon vor Publikum gespielt hatten, haben wir in einer Woche im Grunde genommen das ganze Album eingespielt. Ich fuhr dann irgendwann noch mal hin und habe gesungen und es kamen die Chöre dazu. Aber was die Band angeht, sind wirklich innerhalb einer Woche die 12 Lieder im Kasten gewesen.
Vergleichen Sie ihre Alben miteinander?
Als wir die erste Platte „Von Engeln und Schweinen“ damals aufgenommen haben, das war 2009 oder 2010, kamen wir von der Straße und waren eigentlich vollkommen überfordert mit dem, was da im Studio passiert. Das war eine Welt, die kannten wir so überhaupt nicht. Es ging plötzlich um Streicherarrangements, um Gastmusiker, die dort auftauchten oder oft auch auftauchten, wenn wir gar nicht da waren, aber später auf dem Album zu hören sind. Das hat uns alles ein bisschen überfahren, aber nicht unangenehm. Wir fanden es natürlich ganz toll damals, dass soviel gemacht wurde und so viel passiert. Eine eigene Sprache, einen eigenen Stil hatten wir damals eigentlich noch gar nicht. Wir hatten bis dahin ja auch nur Songs nachgespielt und haben das dann erst nach und nach entwickelt und uns eine eigene Musik zusammengespielt, die über die Jahre immer deutlicher geworden ist. Das hat sich von Album zu Album immer mehr dahin entwickelt, dass wir wussten, wie es klingen soll und was am Ende das Produkt sein soll, aber nicht so konsequent, wie wir bei dem jetzigen Album. Dadurch dass wir diesmal alles live aufgenommen haben, vorher alles klar sein musste und selbst die Soli in dem Moment mit drauf gespielt wurden, ist ein komplett anderer Sound entstanden, als wir ihn bisher hatten. Auch was die Instrumente oder den Sound angeht, ist einiges dazugekommen. Es gibt sehr sphärische Klänge, die von verschiedensten Tasteninstrumenten kommen, es gibt sehr schöne Gitarren-Slide-Soli. Es ist einiges an Sounds dazugekommen und an Atmosphären, die wir vorher so noch nicht hatten oder die eben konstruiert wurden. Diesmal sind sie aber wirklich so gespielt und so kann man sie auch auf die Bühne bringen.
Wenn Sie einen Satz mit dem Wort „Klangkosmos“ bilden würden, wie würde dieser Satz lauten?
Da wir uns genau vorher überlegen mussten, wie wir diese Platte aufnehmen, weil wir es eben live aufnehmen wollten, mussten wir uns wirklich über jede Zutat für die Lieder vorher einigen und so ist zu dem Klangkosmos einiges hinzu gekommen. Es gibt Tasteninstrumente, die wir vorher noch nicht benutzt haben, Slide-Gitarren sind dazugekommen und das alles ergibt ganz andere Klänge, als sie auf den vorherigen Alben vorkommen. Vor allem ist es aber auch so, dass wir diese Klänge live auf der Bühne ganz leicht reproduzieren können, weil sie eben nicht dadurch entstehen, dass eigentlich 20 Spuren über einander liegen, wir aber auf der Bühne nicht 20 Musiker sind. Diesmal haben wir diesen Klangkosmos zu sechst erzeugt. Das macht es auf der einen Seite einfacher, aber eben auch wuchtiger. Das Album hat eine ziemliche Wucht.
Unter welchem Stern steht eigentlich der Albumtitel „Fasst euch ein Herz“?
Der Satz „Fasst euch ein Herz“ hat ja in der heutigen Zeit schon fast etwas Parolenhaftes. Das kann man bestimmt positiv, wie negativ sehen. Es ist eine sehr verrohte Zeit, es droht gerade wieder alles sehr rau zu werden da draußen oder ist es sogar schon. Insofern ist dieser Satz „Fasst euch ein Herz“ genau so gemeint und auch nicht besonders privat gemeint, sondern wirklich als Parole, als Aufforderung an die Menschen „mit dem Herzen zu denken“, wie Konstantin Wecker so schön sagt.
Um welche Themen drehen sich die Songs?
Es gibt in jeder Art von Musik wahrscheinlich diesen großen Themenbereich Liebe. Der muss immer vorkommen, der muss auch bei mir immer vorkommen, weil das Thema Liebe sich über ein Leben weiter entwickelt und man immer neue Gedanken oder Gefühle dazu hat. Es ist über die letzten Jahre aber auch immer gesellschaftlicher und gesellschaftsrelevanter geworden. Nachdem wir die ersten Jahre, wie gesagt, sehr viel auf der Straße spielten und auf der Straße diese Gesellschaft an uns vorbeizog und wir uns Gedanken dazu machten, wie die so rüberkommt, haben wir in den letzten Jahren sehr viele Liedermacher und Musiker kennengelernt, von Norbert Leisegang über Wenzel, Prinz Chaos, Cynthia Nickschas bis hin zu Konstantin Wecker. Mit ihnen haben wir gerne mal länger gesessen und die eine oder andere Flasche Rotwein zusammen getrunken. Dabei haben wir festgestellt, dass unter Musikern doch relativ klar ist, dass alle das Gefühl haben, irgendetwas läuft grundsätzlich schief in dieser Welt und jeder auf seine Art und Weise textet dagegen an. Es ist natürlich ein schönes Gefühl zu merken, dass man mit dieser Idee von einer anderen, vielleicht einer besseren Welt, nicht alleine ist, sondern dass man sich in einer Gruppe Gleichdenkender bewegt. Das spiegelt sich auf dieser Platte mehr denn je wieder.
Haben Gastmusiker mitgewirkt, wenn ja, welche?
Wir haben auf der Platte ein paar Gastmusiker und Gastschreiber dabei. Ein Lied haben wir zum Beispiel mit Norbert Leisegang von Keimzeit zusammen geschrieben. Das war sehr schön. Erik und ich haben uns im Frühjahr 2015 mit ihm in Brandenburg getroffen, in einem kleinen Häuschen im Wald zwischen vielen kleinen Seen. Wir haben das eine oder andere Lagerfeuer angezündet, abends schön zusammen gegessen und uns immer wieder hingesetzt und versucht zusammen Texte und Lieder zu schreiben. Eines ist daraus entstanden, es heißt „Die Auflösung“ und ist auch auf dieser Platte gelandet. Dann gibt es Cynthia Nickschas mit der wir seit 2 Jahren hin und wieder zusammen Musik machen. Wir haben schon öfter zusammen auf der Bühne gestanden und Cynthia und ich haben viel zusammen gesungen. Dabei haben wir gemerkt, dass unsere Stimmen wahnsinnig gut zusammenpassen. Sie hat eine sehr rotzige, rockige Stimme, was mir sehr gut gefällt, weil es eine ungewöhnliche Frauenstimme ist. Die beiden Stimmfarben passen irgendwie wahnsinnig gut zusammen. Dann gibt es noch Sarah Lesch, eine junge und ganz fantastische Liedermacherin mit einer sehr feinen und zerbrechlichen weiblichen Stimme – ganz schön. Sie singt in dem Lied, das wir mit Norbert Leisegang zusammen geschrieben haben. Konstantin Wecker haben wir über Cynthia Nickschas und Prinz Chaos kennengelernt, die sowohl bei uns auf der Bühne als Gäste waren, als auch bei ihm auf der Bühne. So kamen wir in den Genuss, im letzten Jahr einige Konstantin Wecker Konzerte anzuhöhren, was sehr schön war. Dadurch haben wir eben auch Zeit mit ihm verbracht und es entstand die Idee, dass man vielleicht mit ihm zusammen etwas singen könnte. Er singt nun den Refrain von „Fasst euch ein Herz“ mit.
Was möchten Sie mit diesem Album beim Publikum bestenfalls bewirken?
Ich hab das Gefühl, das wir mit der Platte „Fasst euch ein Herz“ da angekommen sind, wo wir musikalisch auch stehen wollen. Wie das dann beim Publikum ankommt, kann man vorher natürlich überhaupt nicht sagen, aber ich hoffe natürlich, dass die Leute genau das darin hören, was wir hinein gespielt haben, nämlich, dass sie uns genau so hören, wie sie uns kennen. Musikalisch und textlich ist es eine logische Weiterentwicklung von dem, was wir bisher gemacht haben. Wir sind von der Straße irgendwann auf die Bühne gekommen und das ist es auch, was man der Musik auf dieser Platte anhört. Man hört weniger Straße als früher und mehr Bühne, ob Theater- oder Kinobühne. Die Musik ist teilweise Kino, teilweise Theater und ein ganz kleiner Hauch Straße ist auch manchmal noch dabei.
Warum haben Sie einen Teil der Finanzierung des Albums über eine Crowdfunding-Aktion unternommen?
Ja das ist wunderschön, mit diesem Crowdfunding. Wir haben ja früher viel mit Plattenfirmen experimentiert oder die haben mit uns experimentiert, wie man es auch immer sehen will. Das war schon o.k., da waren auf jeden Fall sehr viele gute Momente dabei und sie haben uns auf unserem Weg nicht nur begleitet, sondern auch wirklich weiter gebracht. Sie haben uns natürlich Türen geöffnet, die wir ansonsten vielleicht nicht aufbekommen hätten. Aber da wir jetzt mit unserem Publikum direkt ausmachen können, ob es eine neue Platte geben soll oder nicht und unser Publikum uns dann Teile der Produktion sozusagen vorfinanziert über das Crowdfunding, ist das auf jeden Fall ein Schritt in Richtung einer größeren Unabhängigkeit, ganz sicher.
Was muss man als Publikum mitbringen, um Felix Meyer gut zu finden?
Was man mitbringen muss, um uns gut zu finden? Naja, man muss jetzt nicht unbedingt ein Buch mitbringen, aber wenn man schon mal eines gelesen hätte, wäre das nicht so schlimm. Ich denke, die Leute, die unsere Musik mögen, haben in ihrem Leben auch schon einige Liedermacher gehört, haben sich vielleicht viel mit Chanson beschäftigt. Ich denke, dass sie auf jeden Fall gesellschaftlich denken, dass sie sich Gedanken über den Stand der Dinge in diesem Land und auf der Welt machen, dass Liebe für sie eine Rolle spielt und dass „Fasst euch ein Herz“ für sie eine Parole sein könnte, die sie anspricht. Das hoffe ich auf jeden Fall.
Was: Felix Meyer „Fasst euch ein Herz“-Tour
Wo: WERK 2
Wann: 15. April 2016, 20 Uhr
Eintritt: 27,70 EUR
Felix Meyer „Fasst euch ein Herz“ – Tour 2016
14.04.16 Berlin Heimathafen
15.04.16 Leipzig Täubchenthal
16.04.16 Jena Volksbad
17.04.16 Dresden Alter Schlachthof
19.04.16 Frankfurt Brotfabrik
20.04.16 Stuttgart Im Wizemann
21.04.16 München Milla
23.04.16 Zwickau Alter Gasometer
24.04.16 Hannover Kulturzentrum Faust
26.04.16 Köln Stadtgarten
27.04.16 Hamburg Knust
28.04.16 Rostock Circus Fantasia
29.04.16 Stralsund Alte Brauerei
30.04.16 Magdeburg Moritzhof
Zum WERK-2-Programm plus Kartenverkauf